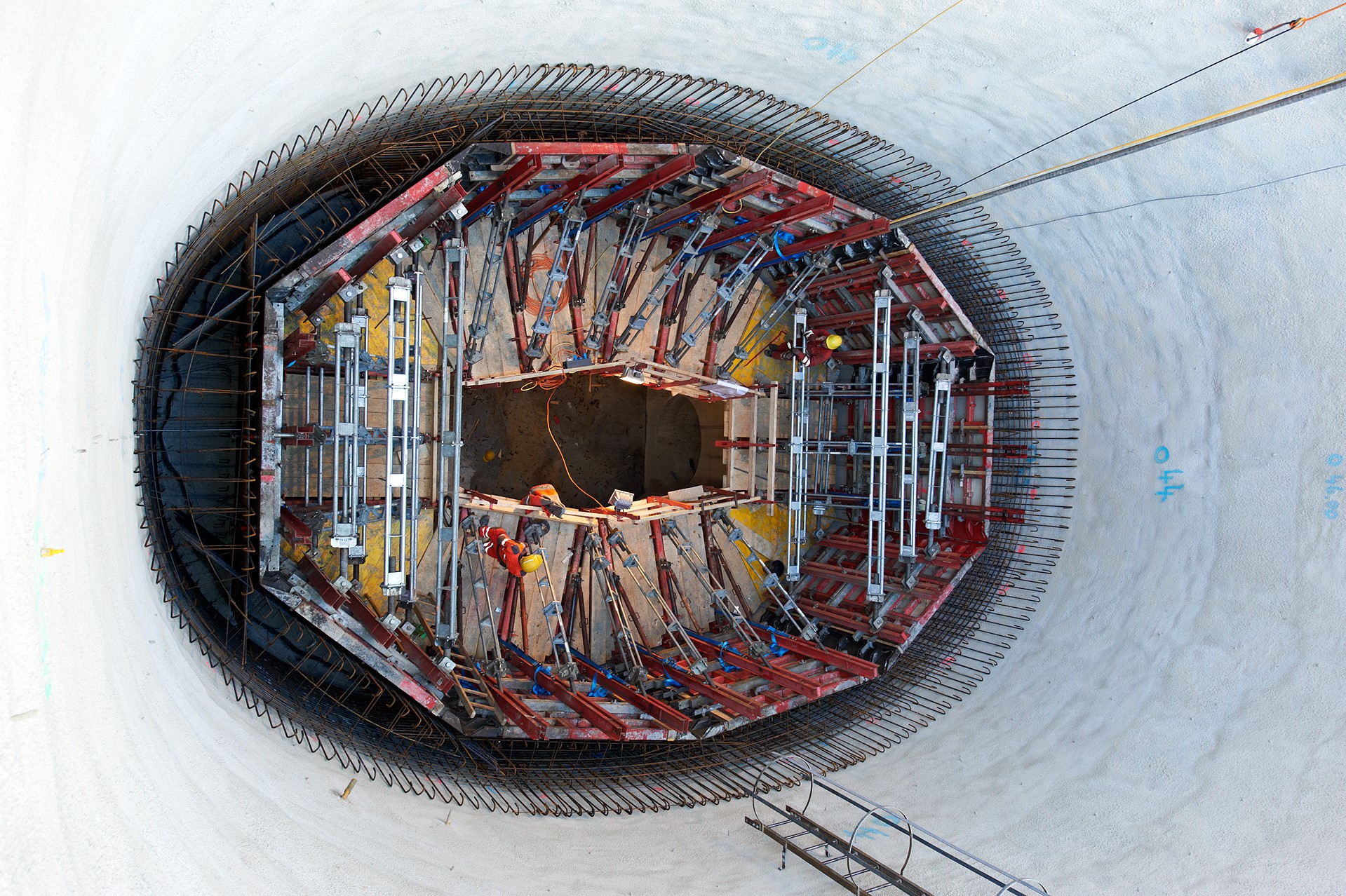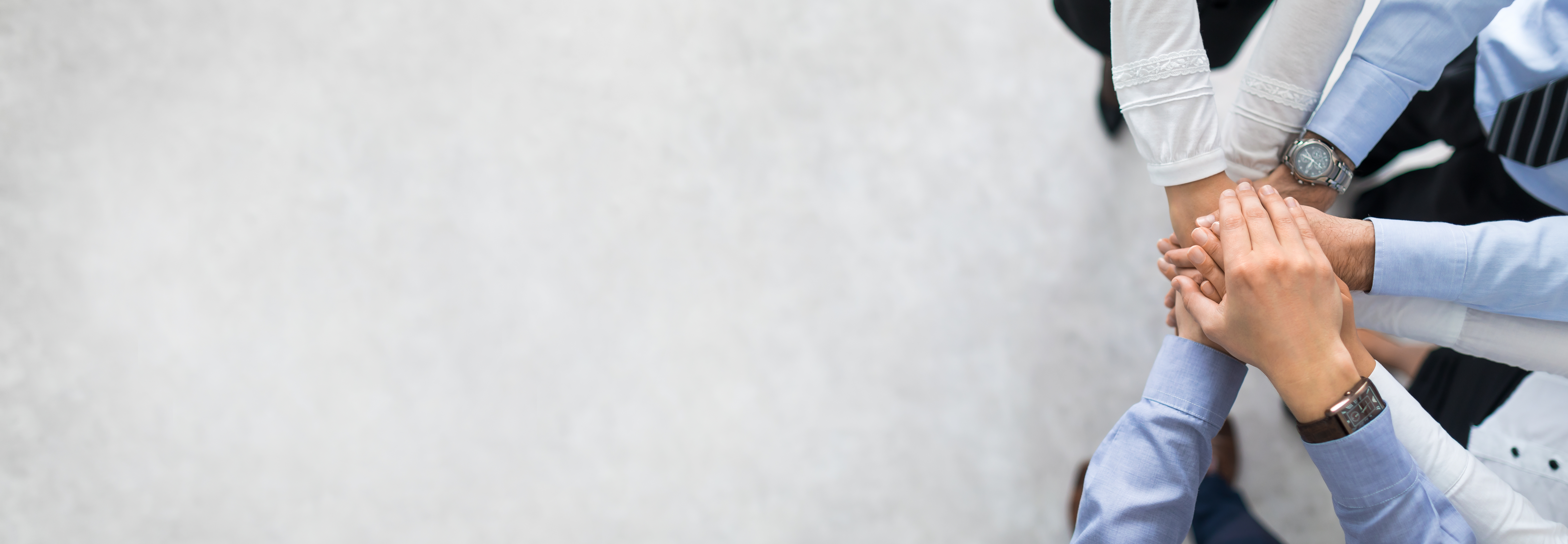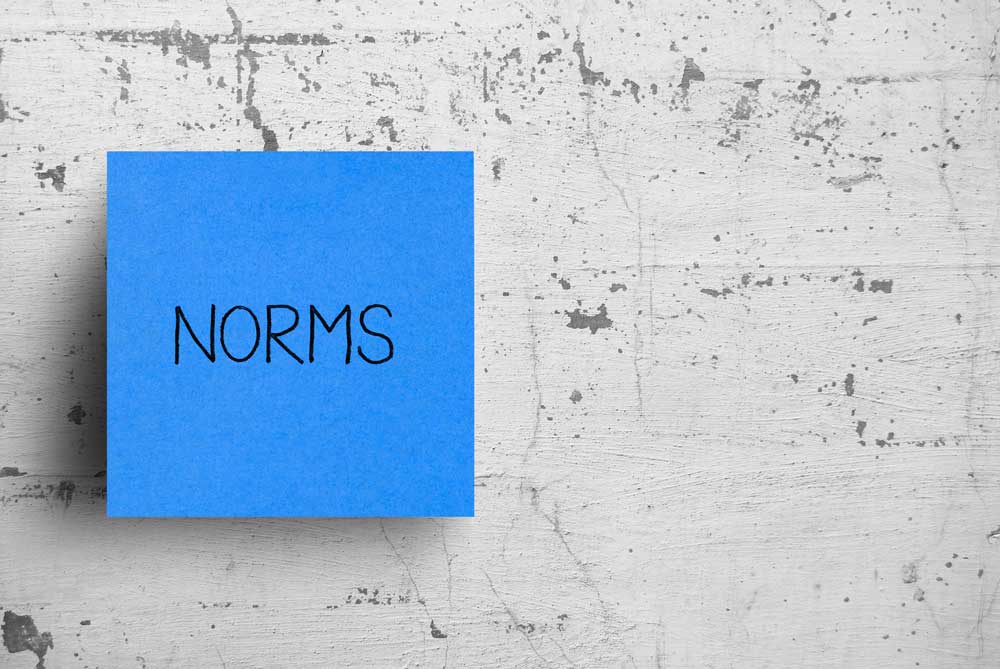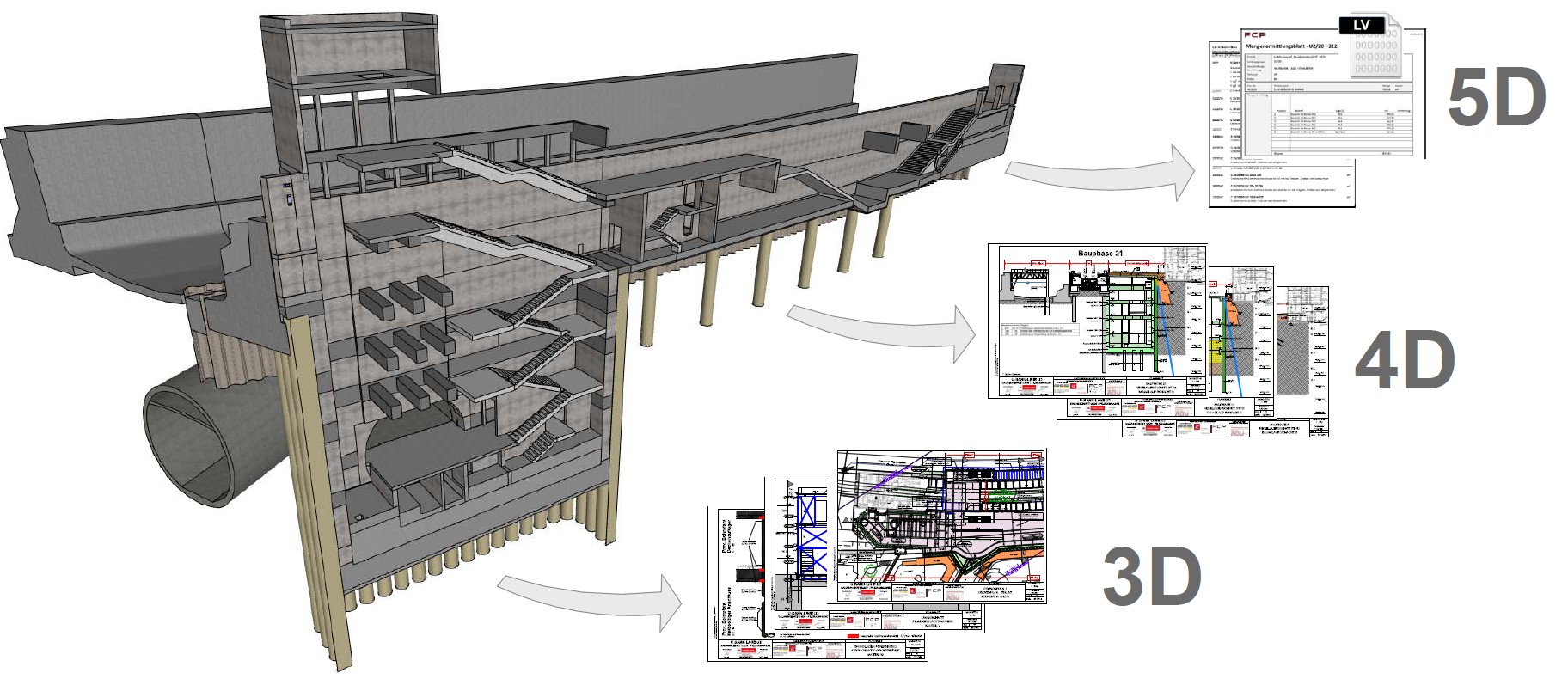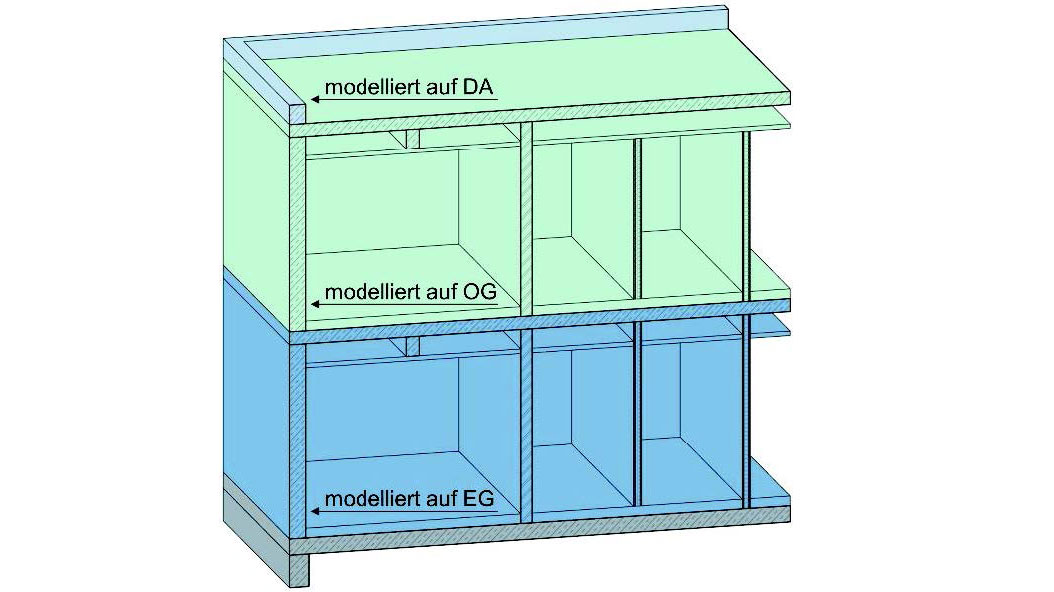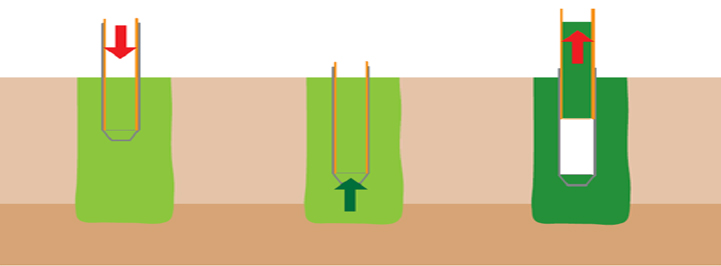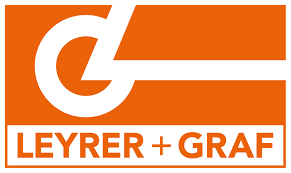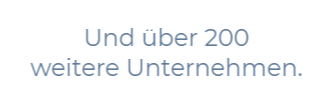Beschreibung:
Der Arbeitskreis „Beschichtung auf Beton und Stahlbeton“ wurde im Rahmen der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV) initiiert, um eine fachlich fundierte und praxisgerechte Grundlage für den Einsatz von Beschichtungssystemen zu erarbeiten. Anlass für die Gründung war die wiederholte Feststellung in verschiedenen ÖBV-Arbeitskreisen, dass das zentrale Thema Beschichtung derzeit weder ausreichend geregelt noch einheitlich definiert ist – insbesondere im Zusammenhang mit der Überarbeitung bestehender Richtlinien.
Ziel des Arbeitskreises ist es, die technischen und normativen Grundlagen für Beschichtungen auf Beton und Stahlbeton (exkl. Estriche) zu analysieren und weiterzuentwickeln. Dabei stehen sowohl die Anwendung in Neubau- als auch Instandsetzungsprojekten im Fokus. Die Arbeiten erfolgen unter Berücksichtigung der teils unübersichtlichen und widersprüchlichen Situation bestehender Regelwerke, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Dazu zählen unter anderem:
* die zurückgezogene DAfStb-Richtlinie SIB (2001/Gelbdruck 2018),
* die DIBt TR Instandhaltung von Betonbauteilen (ICH 2020),
* das DAfStb-Heft 638,
* sowie die Bezüge zu Beschichtungen in ÖBV-Richtlinien wie Garagen & Parkdecks, E&I, Tunnelbeschichtung, Spritzfolie etc.
Ein besonderer Handlungsbedarf ergibt sich auch aus der bestehenden Praxis im Rahmen der E&I-Richtlinie, wonach das ÖBV-Gütezeichen ausschließlich auf Basis von Instandsetzungsreferenzen vergeben werden kann – obwohl die Beschichtungsarbeiten im Neubau nahezu identisch sind.
Der Arbeitskreis verfolgt daher das Ziel, durch eine systematische Aufarbeitung und Neudefinition der Anforderungen an Beschichtungen eine praxisorientierte, anwendbare und zukunftssichere Grundlage für Planung, Ausschreibung und Ausführung zu schaffen. Dabei sollen auch Aspekte der Qualitätssicherung, der Schnittstellenkoordination und der Anerkennung von Leistungen in Neubauprojekten Berücksichtigung finden.
Zusammengesetzt aus:
ehrenamtlich tätigen Fachleuten (maßgebliche Vertreter der Auftraggeber, Bau- und Baustoffindustrie, Ingenieurbüros, Prüfanstalten und Wissenschaft).

Beschichtung